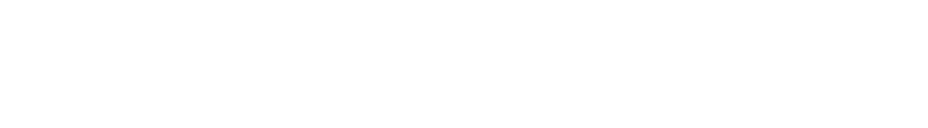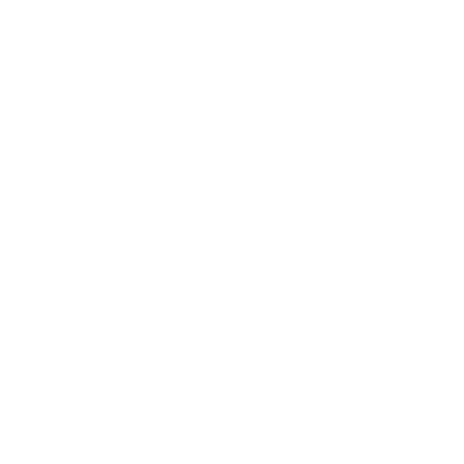Gebäudeverzeichnis
Unterwöhrd - ehem. "Wasserkunst" mit Triebwasserstollen der Saline, heute nicht überbaut
Primärkatasternummer: 827 (früher 824)
Besitzer: 1827
K. Salinenverwaltung Hall
Besitzerliste
1754: Erstellung einer "Wasserkunst" an der Nordwestspitze des Unterwöhrds.
1802/04: Übergang der Saline an den württembergischen Staat.
Besitzer laut Primärkataster 1827: Königl. Salinenverwaltung Hall
1842: Die königliche Staatsfinanzverwaltung überträgt nach der Verlegung der Saline in den Neubau nördlich der Altstadt die nicht mehr genutzten Gebäude und Flächen an die Stadtgemeinde Hall.
1844: Die "Wasserkraft am Unterwöhrd, mit den dazu gehörigen Gebäulichkeiten und Plätzen beim rothen Steg" wird von der Stadtgemeinde an den Stadtrat Rupp verkauft und als Ölmühle genutzt.
1879/1880: abgebrochen und mit dem Neuen Solbad überbaut.
Beschreibungen
historische Beschreibungen
1827: Wohnhaus und Mühle mit 34,9 Ruten, Oek.Anbau 8,4 Ruten, Gebäude 13,9 und 34,6 Ruten, zwei Stallungen mit insgesamt 10,5 Ruten, Einfahrt und Hofraum 1/8 Morgen, 1 Ruten, insgesamt 3/8 Morgen, 7,3 Ruten Grundfläche beim Kocher
"Wasserkunst" und Triebwasserstollen auf dem Unterwöhrd
Der unter dem Unterwöhrd verlaufende, aus Ziegelsteinen gemauerte "Triebwasserstollen" ist der letzte erhaltene Rest einer sog. "Wasserkunst" der Saline. Der Bau dieser Anlage hängt mit der Einführung der Luftgradierung in der Saline ab den 1740er Jahren zusammen, mit der eine erhöhte Salzproduktion und eine stark gesteigerte Entnahme von Sole (salzhaltigem Wasser) aus dem Haalbrunnen einherging. Nach den Plänen des Brunnenbaumeisters Caspar Walther aus Augsburg entstand 1754 ein Pumpwerk, das in einem über dem Haalbrunnen errichteten Turm untergebracht war. Als Antrieb für diese Pumpen diente eine "Wasserkunst" an der Nordwestspitze des Unterwöhrds. Hier befand sich ein Mühlrad, zu dessen Antrieb der Triebwasserstollen durch den gesamten Unterwöhrd gegraben wurde. Nur an den beiden Enden der Kocherinsel verlief der Stollen jeweils ein kurzes Stück offen als Kanal, die restliche Strecke war er als Tunnel angelegt. Ein 86 m langes Kunstgestänge, das mit Hilfe eines Stegs den Kocherarm zum Haalplatz überquerte, führte vom Wasserrad zum Pumpwerk am Haalbrunnen. Nach der Inbetriebnahme der neuen Saline nördlich der Altstadt in den 1840er Jahren (Bereich Salinenstraße) wurden die nun nicht mehr genutzten alten Salinenbauten auf dem Haalplatz und auf dem Unterwöhrd vom württembergischen Staat an die Stadtgemeinde Hall übertragen. Während die Bauten auf dem Haalplatz abgerissen wurden, blieb die "Wasserkunst" bestehen. 1844 veräußerte die Stadt das Anwesen in Privatbesitz. Es wurde in der Folge als Ölmühle genutzt, aber für den Bau des neuen Solbads bis 1880 abgebrochen.Der Triebwasserstollen blieb erhalten und wurde als Abwasserkanal für das Solbad genutzt. 1917 gab es sehr weit gediehene Pläne der Stadtverwaltung, eine Turbine in den Stollen einzubauen, mit der die Pumpen für das Sole- und Süßwasserreservoir des Solbads angetrieben werden sollten. Dies unterblieb aber offenbar, vermutlich aufgrund eines Einspruchs durch den Stadtmühlenbetreiber Obenland. Von 1929 haben sich noch einmal Hinweise auf Bauarbeiten erhalten, bei denen unter Nutzung des alten Kanals eine "Spüleinrichtung" erstellt werden sollte, um den Auslauf vom Solbad in den Kocher von Schlamm zu befreien. Mit dem Abbruch des Solbads 1968 hat der Stollen seine Funktion endgültig verloren. Er hat sich in seinem unterirdischen Verlauf aber offenbar weitgehend erhalten. Teile wurden im Frühjahr 2014 bei Bauarbeiten für die Neuanlage eines Spielplatzes auf dem Unterwöhrd aufgedeckt. Vorhanden ist auch noch ein Teil des Einlaufs an der Südostspitze der Kocherinsel.
Über den Unterwöhrd verliefen auch Soleleitungen. Ein Teil des in Wilhelmsglück (heute Gde. Rosengarten) gewonnenen Steinsalzes wurde dort mit Wasser aus dem Kocher aufgelöst und durch eine 1828 in Betrieb genommene, 10 km lange Leitung aus hölzernen Teicheln in die Haller Saline gepumpt. Ab 1891 verarbeitete die Haller Saline Sole, die aus zwei Bohrlöchern bei Tullau gewonnen und durch gußeiserne Rohre nach Hall geleitet wurde. Offensichtlich nutzte man im Stadtgebiet dieselbe Trasse, möglicherweise auch die selben Leitungen. Diese führten am Westufer des Kochers entlang, über das Stauwehr zwischen Lindach und Unterwöhrd auf die Kocherinsel, über das Grasbödele und den Sulfersteg auf den Haalplatz und von dort der Salinenstraße folgend zur Saline nördlich der Altstadt. Eine weitere, kürzere Soleleitung brachte Salzwasser aus dem Haalbrunnen in das alte und ab (Simon: Salz und Salzgewinnung, S. 100ff).
Besonderheiten
Anzeige für ein „Strom- und Wellenbad“ im Maschinen-Radhaus der „Wasserkunst“ von 1839
„Hall. (Neue Badanstalt im Kocherfluß.) Das von Oberamtsarzt Dr. Dürr angeordnete Strom- und Wellenbad ist in dem – auf dem großen Unterwöhrd befindlichen Maschinen-Radhaus eingerichtet und zum Gebrauch geöffnet.
Die Taxe für ein Bad ist zu 6 Kr. stadträthlich festgesezt, und Salinenzimmermann Gräter als Badwärter bestellt worden, an welchen sich wegen des Gebrauchs zu wenden ist.
Den 15. Juli 1839
Stadtpflege, Fr. Boelz
Aerztlicherseits sey nachträglich noch Folgendes bemerkt:
Erfahrungsmäßig bringt der Wellenschlag durch seinen Druck auf Nerven und Gefäße der Haut, durch seinen Einfluß auf die Athmungs- und Unterleibsorgane Wirkungen hervor, deren Heilkraft durch keine Bewegung der Badenden im Bade, durch keine Douche. durch keine Regen- und Staubbäder ersezt werden kann.
Daher nützen Bäder mit Wellenschlag in langwierigen, gichtischen und nervösen Krankheiten im Allgemeinen, in Kopf- und Unterleibsübeln, in Schwäche der Haut und daher kommender Geneigtheit zu Rheumatismen, Katarrhen u.s.w. insbesondere.
Dieses jetzt nicht nur ganz zweckmäßig, sondern auch sehr bequem eingerichtete und so nahe gelegene Strom- und Wellenbad beschränkt aber seinen Nutzen nicht allein auf Besserung und Heilung oben angedeuteter Krankheiten, sondern es bewahrt auch vor Verweichlichung und dient daher auch den Gesunden als ein erkräftigendes Schutzmittel.
Dr. Dürr“
Anmerkung: Es handelte sich noch nicht um ein Schwimmbad im heutigen Sinn, sondern ein Flußbad, das wahrscheinlich mit sehr wenig Bauten auskam. Wie lange dieses Wellenbad an diesem Ort betrieben wurde, ist unbekannt. Da bislang keine weiteren Hinweise darauf bekannt sind, dürfte diese Einrichtung nicht sehr lange bestanden haben.
Quellen
Literatur:
- Theo Simon: Salz und Salzgewinnung im nördlichen Baden-Württemberg (Forschungen aus Württembergisch Franken; Bd .42),Sigmaringen 1995, S. 100-105
- Haller Wochenblatt Nr. 57 v. 17.07.1839, S. [2]
Archivalien:
- StadtA Schwäb. Hall 21/463 (Verkauf der Wasserkraft am Unterwöhrd, 1844)
- StadtA Schwäb. Hall 21/761 (Anlage einer Turbine im Solbad, 1917ff)
- StadtA Schwäb. Hall 21/2201 (Überlassung von ehemaligen Salinenbauten und -flächen durch die Staatsfinanzverwaltung an die Stadt Schwäbisch Hall, 1842ff)